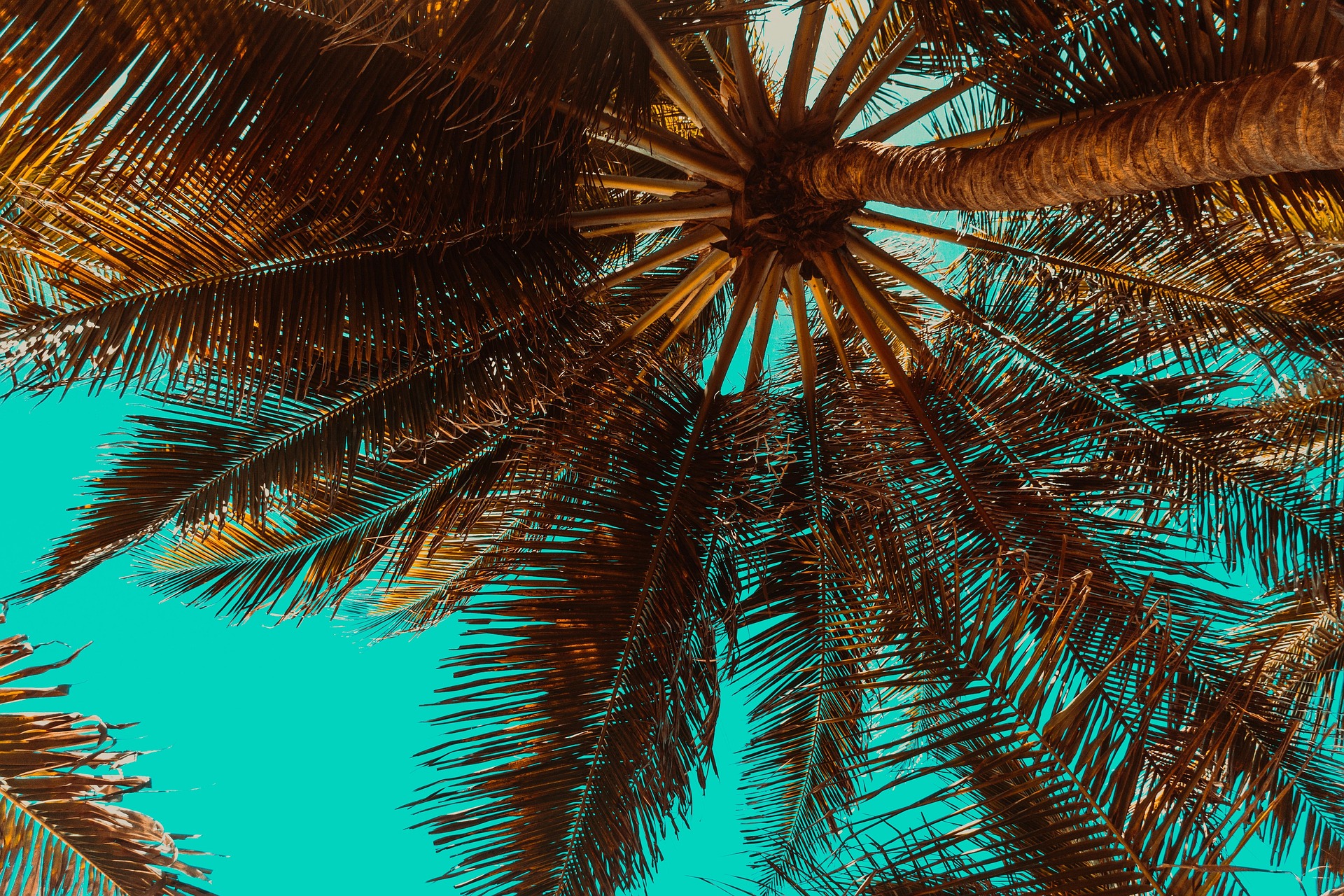Rund 550.000 Menschen haben laut KfW-Gründungsmonitor 2022 im Jahr 2021 in Deutschland den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Damit lag die Gründungsquote bei 107 Gründungen je 10.000 Erwerbsfähige. Viele dieser Unternehmer erhoffen sich weniger Bürokratie, eine flexible Gestaltung des Geschäftsalltags und bessere Chancen auf dem Markt. Doch welche Risiken lauern zwischen den Versprechungen einer Selbstständigkeit? Wie lässt sich das rechtliche Fundament so legen, dass es nicht schon im ersten Jahr bröckelt? Und welche steuerlichen Hürden werden gerne übersehen, bis es zu spät ist?
Warum die Standortwahl zum Dreh- und Angelpunkt wird
Die Wahl des richtigen Landes entscheidet über weit mehr als die Steuerlast. In vielen Staaten bestimmt die Rechtsform über die Haftung, die Kapitalausstattung und die Anerkennung durch Banken. Während klassische GmbH-Modelle in Europa oft Mindestkapital erfordern, locken andere Länder mit flexibleren Vorgaben. So können Gründer in bestimmten Regionen mit wenigen tausend Euro eine Gesellschaft ins Handelsregister eintragen lassen.
Große Unterschiede bestehen auch beim Zugang zu Märkten. Wer etwa eine Firma in Dubai gründen möchte, profitiert vom Zugang zu Freihandelszonen, die internationale Investoren mit steuerlichen Vorteilen und vereinfachten Genehmigungsverfahren anziehen. Allerdings müssen diese attraktiven Rahmenbedingungen gegen mögliche Einschränkungen wie Residenzpflichten oder lokale Partnerregelungen abgewogen werden. Rechtliche Beratung vor Ort ist deshalb unverzichtbar.
Kulturelle Unterschiede prägen Geschäftsmodelle
Neben juristischen Fragen spielt die Geschäftskultur eine entscheidende Rolle. Internationale Analysen wie von CB Insights 2021 zeigen, dass rund 90 Prozent aller Start-ups in den ersten Jahren scheitern, meist wegen Problemen wie fehlender Marktanpassung oder Finanzierungsengpässen. Kulturelle Barrieren gehören zwar nicht zu den am häufigsten genannten Ursachen, können den Erfolg einer Auslandsgründung jedoch erheblich beeinflussen. Verhandlungen laufen in vielen Ländern informeller, Entscheidungen ziehen sich länger hin, und Hierarchien haben häufig mehr Gewicht als in Deutschland. Wer diese Unterschiede unterschätzt, riskiert Missverständnisse, verzögerte Projekte und ein beschädigtes Ansehen im neuen Markt.
Steuersysteme entscheiden über die Attraktivität
Die Steuerpolitik bleibt ein zentraler Hebel für eine internationale Firmengründung. Länder wie Irland oder Zypern locken regelmäßig mit vergleichsweise niedrigen Unternehmenssteuersätzen oder speziellen Steueranreizen für Tech-Start-ups und grüne Innovation. Entscheidend ist, die effektive Steuerlast zu kennen – denn sie kann sich deutlich von den veröffentlichten Steuersätzen unterscheiden.
Ein weiterer maßgeblicher Faktor sind die Doppelbesteuerungsabkommen (DBA). Deutschland hat mit inzwischen etwa 96 Staaten entsprechende Abkommen geschlossen, um doppelte Besteuerung von Einkommen und Gewinnen zu verhindern
Fallstricke bei Umsatzsteuer und Quellensteuer
Auch indirekte Steuern wie Umsatzsteuer und Quellensteuer stellen häufig eine Hürde dar:
- Umsatzsteuersätze variieren erheblich zwischen Ländern und beeinträchtigen insbesondere grenzüberschreitende Dienstleistungen.
- Quellensteuer auf Dividenden, Zinsen oder Lizenzgebühren kann die tatsächliche Rendite mindern, wenn kein Abkommen Entlastung gewährt.
- Komplexität im Steuerrecht ist laut einem Bericht der Europäischen Kommission 2024 einer der größten Wettbewerbsnachteile für Unternehmen
Die Kombination aus global unterschiedlichen Indirektsteuern und komplizierten DBA-Regeln macht eine sorgfältige Steuerplanung unerlässlich, um Start-up-Verluste zu vermeiden.
Finanzierung und Bankverbindungen sichern Liquidität
Die Kapitalbeschaffung ist im Ausland häufig leichter, aber auch riskanter. Internationale Banken bieten Start-ups attraktive Kredite, doch verlangen im Gegenzug oft zusätzliche Sicherheiten. In manchen Staaten dürfen nur Inländer bestimmte Kreditlinien beantragen, was die Unternehmensgründung erheblich erschwert. Alternative Finanzierungsformen wie Venture Capital oder Business Angels sind zwar weltweit verbreitet, funktionieren jedoch nach unterschiedlichen Regeln.
Auch die Wahl der Bankverbindung ist nicht trivial. Manche Finanzinstitute verlangen umfangreiche Nachweise, um Geldwäsche vorzubeugen. Der Prozess kann Monate dauern, wenn Gründer unvorbereitet sind. Selbst einfache Überweisungen können blockiert werden, wenn Compliance-Regeln nicht erfüllt sind.
Förderprogramme im Ausland nutzen
Viele Länder versuchen, Existenzgründer und Unternehmer mit Förderprogrammen anzulocken. Zuschüsse für Forschung und Entwicklung, Steuererleichterungen für Investitionen oder Start-up-Visa sind beliebte Instrumente. Laut einer Erhebung der Europäischen Kommission von 2022 bieten 19 von 27 EU-Staaten spezielle Gründerprogramme für ausländische Investoren an.