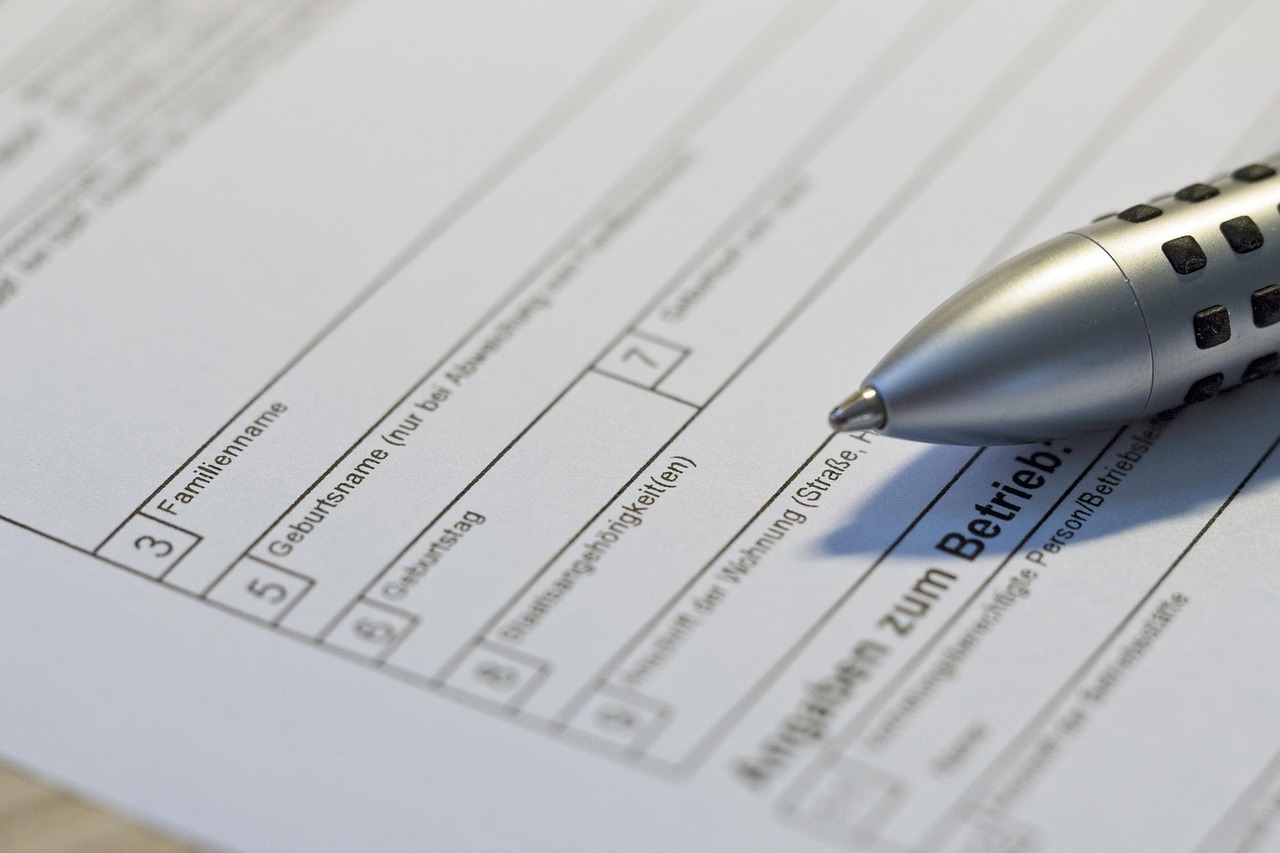Existenzgründer benötigen oftmals Fremdkapital, um eine Geschäftsidee erfolgreich umsetzen zu können. Anstehende Investitionen wie z. B. Ware, Rohstoffe, Fahrzeuge oder Werkzeuge können meist nicht aus dem vorhandenen Eigenkapital getätigt werden.
Daher kommen im Rahmen einer Existenzgründung oftmals Förderdarlehen zum Einsatz. Diese sind für Gründer und junge Unternehmen sehr attraktiv, da sie zu sehr günstigen Zinssätzen aufgenommen werden können. Zusätzlich enthalten sie eine tilgungsfreie Anlaufzeit. Dies bedeutet, dass das Darlehen nicht direkt zurückgezahlt (getilgt) werden muss. Vielmehr hat man bis zu zwei Jahre Zeit, bevor man die erste Rate tilgen muss. Dies ist natürlich sehr hilfreich für den Aufbau von Liquidität auf dem Geschäftskonto. Reguläre Bankdarlehen muss man größtenteils direkt nach der Auszahlung wieder anteilig zurückzahlen.
Um ein staatlich gefördertes Darlehen wie z. B. das KfW-StartGeld oder Darlehen von Landesbanken zu beantragen, muss ein professioneller Businessplan erstellt werden. In diesem werden alle Bestandteile des Geschäftsmodells inklusive eines aussagekräftigen Finanzplans erläutert.
Ein wichtiges Kapitel im Businessplan ist die Erläuterung der Rechtsform. Viele angehende Selbstständige stellen sich die Frage, ob man in einer bestimmten Rechtsform am Markt agieren muss, um ein Förderdarlehen erhalten zu können.
In diesem Artikel möchten wir erläutern, inwieweit die Rechtsform einer Selbstständigkeit bei der Beantragung eines geförderten Darlehens eine Rolle spielt.
Förderdarlehen – ein Überblick
Staatlich geförderte Darlehen sind bei Existenzgründern sehr beliebt. Sie unterscheiden sich von klassischen Bankdarlehen und sollen Gründern dabei helfen, die Selbstständigkeit in Ruhe aufzubauen und sich nachhaltig erfolgreich am Markt etablieren zu können. Später sollen natürlich z. B. Arbeitsplätze geschaffen werden, damit der Wirtschaftsstandort Deutschland gestärkt wird.
Als konkrete Vorteile eines geförderten Darlehens sind die folgenden zu nennen:
- Niedrige Zinsen: Der Zinssatz liegt ca. 1,5 Prozentpunkte unterhalb der Zinsen, die man bei klassischen Bankdarlehen entrichten muss. Konsum- oder Privatkredite sind nochmals deutlich teurer.
- Tilgungsfreie Anlaufphase: Förderdarlehen müssen erst nach einer gewissen Zeit getilgt werden. Meist liegt die tilgungsfreie Zeit bei ein bis zwei Jahren und ist abhängig von der Gesamtlaufzeit des Darlehens.
- Unterschiedliche Finanzierungsvolumen möglich: Das KfW-StartGeld kann beispielsweise bis zu einem Volumen von 125.000 Euro ausgezahlt werden. Andere Förderdarlehen von Landesbanken liegen bei 40.000 – 50.000 Euro. Mit diesen Summen lassen sich bereits einige Gründungsideen oder ein Unternehmenswachstum gut realisieren.
- Lange Laufzeit: Die Mindestlaufzeit liegt bei fünf Jahren, die Darlehen können allerdings auch über z. B. zehn Jahre zurückbezahlt werden. Dies sorgt für niedrige monatliche Raten, sodass auch weiterhin aus dem Cash-Flow des Unternehmens investiert werden kann.
- Für die Beantragung ist ein Businessplan notwendig, bei dessen Erstellung staatlich geförderte Berater unterstützen können.
- Oft können Förderdarlehen ohne den Einsatz von Eigenkapital gewährt werden.
Gängige Rechtsformen bei Existenzgründungen
Grundsätzlich wird zwischen Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften unterschieden. Die GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) sowie die Unternehmergesellschaft, kurz UG (haftungsbeschränkt), sind Kapitalgesellschaften.
Für die Gründung einer solchen Gesellschaft ist das Einbringen von Stammkapital notwendig. Bei einer GmbH sind dies generell 25.000 Euro, allerdings ist es auch möglich, mit lediglich 12.500 Euro eine GmbH zu gründen. Die UG (haftungsbeschränkt) kann schon mit 1 Euro formell gegründet werden.
Die Gesellschafter haften nicht mit ihrem Privatvermögen, es wird nur mit dem Vermögen der Gesellschaft gehaftet.
Personengesellschaften sind Einzelunternehmen und GbRs (Gesellschaft bürgerlichen Rechts). Letztere sind von mindestens zwei Personen zu gründen. Bei Personengesellschaften haften die Inhaber oder Gesellschafter unbeschränkt mit ihren privaten finanziellen Mitteln. Dies gilt auch für Freiberufler.
Die Wahl der passenden Rechtsform ist von vielen Faktoren abhängig, beispielsweise vom verfügbaren Eigenkapital, denn das Stammkapital kann nicht fremdfinanziert werden. Darüber hinaus sind der erwartete Umsatz und Gewinn, die mögliche Hinzunahme weiterer Gesellschafter, eine ggf. notwendige Außenwirkung oder auch der Zeitpunkt einer Gründung ausschlaggebend. Ein Einzelunternehmen ist beispielsweise deutlich schneller und einfacher gegründet als eine GmbH, für deren Gründung man einen Termin beim Notar benötigt. Hier gibt es noch mehr Informationen zur Gründung bei der IHK.
Sie suchen den passenden Berater für Ihre Gründung?
Mit unserer kostenlosen Beratersuche finden Sie schnell einen zertifizierten Experten in Ihrer Region, der Sie bei Businessplan, Rechtsformwahl und Förderdarlehen unterstützt.
Gründerfinanzierung: die Rolle der Rechtsform für die Beantragung eines Förderdarlehens
Dies ist jedoch nicht der Fall. Sowohl Personen- als auch Kapitalgesellschaften werden von der KfW oder von Landesbanken gleichermaßen gefördert. Dies bedeutet, dass sowohl Einzelpersonen, z. B. als Freiberufler, als auch Einzelunternehmen die gleiche Möglichkeit zur Förderung haben, wie GmbHs mit mehreren Gesellschaftern. Bei Kapitalgesellschaften werden alle Gesellschafter hinsichtlich der Bonität geprüft. Zu beachten ist, dass die Haftungsbeschränkung einer Kapitalgesellschaft nicht für ein Darlehen gilt.
Auch bei bereits gegründeten Unternehmen gibt es immer wieder Überlegungen, vor der Beantragung eines Förderdarlehens noch schnell die Rechtsform zu wechseln und z. B. eine GmbH zu gründen. Dies ist jedoch absolut nicht notwendig. Sollte tatsächlich beabsichtigt werden, z. B. ein Einzelunternehmen in eine GmbH einzubringen, kann dies im Businessplan als Vorhaben beschrieben werden. Dieser Schritt muss jedoch nicht vor der Kontaktaufnahme zu einer Förderbank erfolgen.
Fazit
Generell ist es wichtig, die Beantragung eines Förderdarlehens detailliert vorzubereiten. Im Businessplan und auch im Finanzplan wird die Entwicklung der nächsten drei Jahre sowie der Wachstumskurs abgebildet. Hierzu gehört auch die Auswahl der passenden Rechtsform, die sich im Zeitverlauf durchaus ändern kann. Allerdings ist es nicht notwendig, bereits eine bestimmte Rechtsform zu gründen oder die Rechtsform zu wechseln, bevor man ein Förderdarlehen beantragt.
Sie möchten sich bei der Wahl der passenden Rechtsform und der Beantragung eines Förderdarlehens professionell beraten lassen? Nutzen Sie gerne unseren kostenlosen Fördercheck zur Orientierung – oder treten Sie direkt über das Kontaktformular mit uns in Kontakt. So bringen wir Sie unverbindlich mit einem passenden Experten zusammen.
FAQ
Muss ich für ein Förderdarlehen zwingend eine GmbH gründen?
Nein, sowohl Einzelunternehmen, Freiberufler, GbR als auch Kapitalgesellschaften wie GmbH oder UG können gefördert werden.
Prüft die Bank meine persönliche Bonität?
Ja, unabhängig von der Rechtsform erfolgt eine Bonitätsprüfung der Gründer bzw. Gesellschafter.
Kann ich meine Rechtsform nach der Darlehensbeantragung noch ändern?
Ja, die Rechtsform kann sich im Zeitverlauf ändern. Wichtig ist nur, dies im Businessplan darzustellen.
Sind Förderdarlehen günstiger als normale Bankkredite?
Ja, sie bieten niedrigere Zinsen, längere Laufzeiten und eine tilgungsfreie Startphase.
Benötige ich Eigenkapital für ein Förderdarlehen?
Nicht zwingend. Viele Förderdarlehen können auch ohne Eigenkapital beantragt werden.
Ist ein Businessplan Pflicht für den Antrag?
Ja, ein professioneller Businessplan inklusive Finanzplan ist Voraussetzung für die Bewilligung.